Der Dokumentarfilm „I Go Gaga, My Dear“ (bokemasu kara, yoroshiku onegaishimasu) (2018) handelt von den Eltern der Regisseurin und Dokumentarfilmerin Nobutomo Naoko. Die 87-jährige Mutter erkrankt an Demenz, darauf beginnt der 95-jährige Vater zum ersten Mal in seinem Leben den Haushalt zu schmeißen. Mit welchen Gedanken erschuf die Tochter diese Dokumentation, in der sie ihre Eltern filmisch festhält?

Woher kommt Ihre Leidenschaft zum Dokumentarfilm?
Eigentlich galt mein Interesse dem Werbetexten, also fing ich nach der Uni an, in der Werbeabteilung des Süßwarenherstellers Morinaga zu arbeiten. Doch kurz danach kam es zum „Glico Morinaga“-Vorfall*. Das war ein Riesending und von den Massenmedien ohne Rücksicht verfolgt zu werden, war eine große Herausforderung. Damals war die Berichterstattung der Medien noch nicht so reguliert, daher wurden wir täglich belagert und entwickelten richtiggehend eine „Medienphobie“. Zu dieser Zeit wurde ich von einer Zeitungsreporterin angesprochen. In einem Artikel wollte sie sich mir als Einzelperson widmen und zum ersten Mal konnte ich die Dinge ehrlich aussprechen. Als ich ihr von meinen Sorgen erzählte, war es, als ob eine große Last von meinen Schultern fiel. Es hat meine Probleme zwar nicht gelöst, aber dass es einen Menschen gab, der sich meine Geschichte anhörte, war wie eine Rettung für mich. Durch diese Erfahrung wurde mein Interesse zum Dokumentarfilm geweckt.
Warum wollten Sie eine Dokumentation über Ihre Eltern drehen?
Als ich mir selbst eine Kamera kaufte, habe ich zur Übung meine Eltern gefilmt. Im Laufe der Zeit wurden die Veränderungen bei meiner Mutter sichtbar. Während des Filmens sagte sie: „Ich bin etwas seltsamer geworden, oder?“. Ich dachte, das sei etwas, das die ganze Welt sehen sollte. Man glaubt, Demenz bedeutet, dass betroffene Personen langsam ihr Fassungs- und Urteilsvermögen verlieren und daher nichts mehr begreifen. Doch tatsächlich bemerken sie die eigenen Veränderungen und daraus entstehen Ängste und Verzweiflung; mit dieser Dokumentation hoffe ich, dass ich dies der Welt auch nach dem Tod meiner Eltern beweisen und mitteilen kann. Doch als ich meine Pläne einem Fernsehsender mitteilte, wurde daraus schneller als gedacht eine richtige Fernsehproduktion. Natürlich habe ich meine Eltern als die Protagonisten vorher um Rat gefragt und als diese überraschend deutlich ihre Zustimmung gaben, wurde das Projekt realisiert.
Wie geht es Ihren Eltern heute?
Bevor der Film veröffentlicht wurde, erlitt meine Mutter seit Ende September 2018 immer wieder multiple Hirninfarkte, daher liegt sie noch immer im Krankenhaus. Mein Vater ist 99 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Er geht selbstständig einkaufen und lebt allein und unabhängig.
Im Film haben Sie in die Handlungen Ihrer Eltern so gut wie nie eingegriffen. Gab es Momente, wo Sie das gesamte Projekt abbrechen wollten?
Als Tochter stand ich durchaus im Konflikt, meinen Eltern zu helfen statt sie zu filmen. Doch das Filmen hat auch mich einige Male gerettet. Zum Beispiel hat sich die Persönlichkeit meiner Mutter, die sich immer um andere Menschen gekümmert und eine positive Einstellung hatte, durch die Erkrankung verändert. Dass sie zu ihrer Tochter sagt: „Ich will sterben!“, das hätte sie früher nie getan. Wenn meine Kamera es nicht aufgenommen hätte, wäre ich sicher schockiert gewesen. Auch wenn das eine Situation war, die man als Tochter anderen Menschen sicher nicht zeigen will, als Regisseurin war ich in der Lage, diese Momente aufzuzeichnen.

Sie selbst litten an Brustkrebs; wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, was glauben Sie, welche Bedeutung die Erkrankung hatte?
Ich brauche nicht mehr viel um glücklich zu sein. Damit meine ich, auch wenn ich mit nur 45 Jahren an Brustkrebs erkrankte, litt ich bis dahin unter meinen eigenen Ansprüchen. Ich bin ledig und kinderlos und so war ich neidisch auf all die Leute, die um mich herum heirateten und Kinder bekamen. Auf der Arbeit verglich ich mich mit meinen Kollegen und ich dachte, ich wäre einfach nicht genug. Ich glaube, dass diese Gedanken auf ganz natürliche Weise kamen, da ich vom Land nach Tōkyō zog und ganz allein mein Bestes gab. Durch den Krebs war ich froh, überhaupt am Leben zu sein. Zu dieser Zeit ging es meiner Mutter noch gut, sie kam nach Tōkyō und kümmerte sich um mich. Ich war dankbar, dass sie sich um mich sorgte und zum ersten Mal war ich mir dieser Dankbarkeit erst bewusst. Seitdem finde ich Ruhe und fühle mich einfach glücklich, am Leben zu sein.
Was hat sich seit der Veröffentlichung des Films verändert?
Da meine Mutter noch im Krankenhaus liegt, hat sie ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Doch jedes Mal, wenn ich sie besuche, sage ich zu ihr, dass „sie der Welt hilft“. Das sage ich vor allem deshalb, weil sie glaubt, durch ihre Krankheit für nichts und niemandem mehr nützlich zu sein. Wenn ich meiner Mutter also mitteile, dass viele Menschen durch den Film neuen Mut geschöpft haben, dann scheint sie das sehr zu freuen. Mein Vater, der in Kure lebt, wurde seit der Veröffentlichung zu einer Berühmtheit, und viele Menschen unterstützen ihn auf freundliche Weise. Wenn er zum Beispiel einkaufen geht, dann sagen die Leute wohl zu ihm: „Väterchen, gestern hast du das gegessen, deshalb musst du heute das nehmen!“ und geben ihm Ratschläge für eine ausgewogene Ernährung. Auf diese Weise gibt die Gesellschaft auf ihn Acht. Es gab eine Zeit, in der meine Eltern sich wegen des ganzen Stresses zurückzogen und mein Vater sich alles allein aufbürdete. Jetzt da die Welt weiß, dass meine Mutter an Demenz leidet, ist es nichts Schlimmes mehr und niemand diskriminiert sie deswegen.
Was möchten Sie Pflegebedürftigen oder Menschen mit an Demenz erkrankten Angehörigen mitteilen?
Dass sie alles positiv sehen sollen. Mein Motto ist: „Glück kommt zu denen, die lachen“. Auch wenn einem nicht nach Frohsinn zumute ist, wenn man lacht, wird man fröhlich. Denn erst wer das Leben genießt, hat gewonnen. Zu sagen, es sei wegen Demenz nicht angebracht, fröhlich zu sein, ist falsch. Niemand kann sagen, wie lange die Pflege dauern wird, deshalb muss man fröhlich sein. Wenn mein Vater und ich während der Pflege glücklich lachen und leben, beruhigt das auch meine Mutter. Ich möchte, dass es den Menschen Freude macht, meinen Film anzuschauen. Im Allgemeinen hält man Demenz für eine beängstigende Krankheit. Die Leute glauben, dass im Kopf etwas kaputt geht, eine Heilung gibt es auch noch nicht. Doch ich denke, wenn sich Verwandte, Pflegekräfte oder Nachbarn den Film ansehen und zusammenarbeiten, verstehen sie, dass man Witze machen und gleichzeitig glücklich und gut leben kann, solange wir uns nur gegenseitig unterstützen
Dieser Artikel wurde für die April-Ausgabe des JAPANDIGEST 2020 von Kei Okishima verfasst und für die Veröffentlichung auf der Website nachbearbeitet.
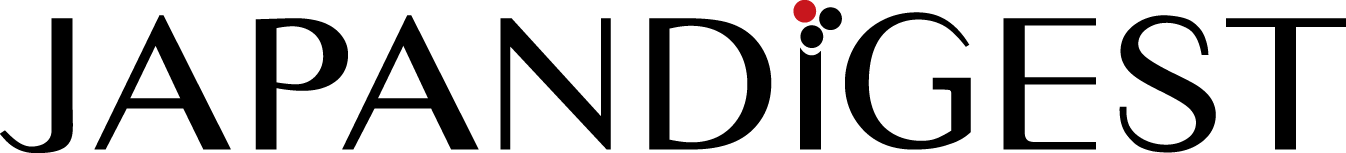




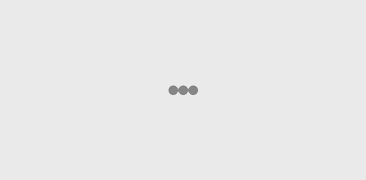




Kommentare