Die Handwerks- und Baukunst findet in den alten japanischen Tempelanlagen, Schreinen und Wohnhäusern sicherlich einen ihrer Höhepunkte. Die traditionellen Gartenanlagen ebenso wie die Zimmermannskunst Japans gelten als Musterbeispiele von Materialgerechtigkeit, sensibler Gestaltung und präziser Ausführung. Als die deutschen Avantgarde-Architekten Bruno Taut und Walter Gropius im letzten Jahrhundert in Japan entdeckten, dass die Formen- und Konstruktionssprache ihrer modernen Architektur in Gebäuden wie dem Katsura-Komplex bei Kyōto (17. Jh.) längst vorgeprägt war, wurde Japan zum Vorbild des modernen Bauens.
Nach den großflächigen Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges übernahm das Land schließlich selbst die Avantgarde-Rolle: Japan wurde zum Großlabor für experimentelle Stadtplanung und Großstadtarchitektur. Der zu dieser Zeit geprägte und von Meisterarchitekten wie Kenzo Tange (1913-2005), Kiyonori Kikutake (1928-2011) oder Kisho Kurokawa (1934-2007) propagierte „Metabolismus“ ist angesichts der beschleunigten Urbanisierung der Welt auch heute noch von Relevanz.
Japanische Architektur en vogue
In Anlehnung an Körper- und Stoffkreisläufe beschreibt der “Metaboismus” die Stadt als organisches, hochdynamisches System, in dem Menschen, Maschinen und Energie kontinuierlich zirkulieren und neue Wachstumsformen ausbilden. Die immense japanische Wirtschaftsleistung, die sich bis in die 1990er Jahre hielt, beschleunigte den Bau- und Experimentierwillen in der japanischen Architekturszene dann noch weiter: es entstanden futuristische Entwürfe, die den Status Japans als führendes Architekturland besiegelten.
Internationale Stararchitekten wie Rem Koolhaas (*1944) oder Steven Holl (*1947) etablierten sich mit Projekten in Japan: die Bau- und Stadtkultur des Landes faszinierte und inspirierte sie offenkundig – und sie eröffnete ihnen auch die Möglichkeit, ihre radikalen Entwürfe wie z.B. beim Nexus World Projekt in Fukuoka (1991ff.) umzusetzen. Heute gelten Altmeister wie Arata Isozaki (*1931) und Yoshio Taniguchi (*1937) als Weltstars; gleichfalls sind Kazuyo Sejima (*1956) oder Kengo Kuma (*1954) sowie der junge Junya Ishigama (*1974) bereits zu einer eigenen Marke geworden.

Kurz: japanische Architektur – die traditionelle ebenso wie die zeitgenössische – hat das gewisse Etwas, das nicht nur Architekten anspricht, sondern auch auf den nicht-fachkundigen Betrachter wirkt. Oder besser: das ungewisse Etwas. Denn es ist keinesfalls einfach zu beschreiben, worin der gemeinsame Charakter der alten Schrein- und Tempelbauten einerseits und der spektakulären modernen Großstadtarchitekturen andererseits besteht. Bei genauerer Betrachtung jedoch finden sich zwei besondere Eigenschaften, die als verbindende Merkmale wahrnehmbar sind und in ihrer Kombination japanische Architektur und Baukunst einzigartig machen.

Materialität und Körperlichkeit
In allen Meisterwerken japanischer Architektur ist eine phänomenale Materialität und Sinnlichkeit zu spüren. Die kluge Behandlung der Hölzer in den alten Tempelbauten, die Stroh- und Lehmästhetik in den Teehäusern der Zen-Meister, der Sichtbeton von Tadao Ando wie auch das Spiel von Glas und Stahl bei SANAA – das alles sind überaus sinnliche Erlebnisse, wirkliche „Material-Erfahrungen“, wie es der japanische Meisterarchitekt Ryoji Suzuki ausdrückt. Solch ausgeprägte Physis gelingt im internationalen Vergleich gegenwärtig wohl nur der sprichwörtlichen Schweizer Architektur, die hinsichtlich ihrer Handwerklichkeit wie auch ihrer Konsequenz mit der japanischen sicherlich auf Augenhöhe ist. Beide Architekturkulturen sind extreme Ausprägungen eines gemeinsamen Architekturverständnisses, das auf einem überaus sinnlichen und konkreten Körpererlebnis fußt.
Voraussetzung dafür ist eine hohe Sensibilität für das Material und dessen Eigenleben. Im geschickten Umgang mit dem konkreten Stoff und dem Körper der Bauwerke bis in die kleinsten Teile liegt das besondere Vermögen dieser Baukunst. Die Meister in diesem Metier wissen mit Rost und Patina, mit Lichtreflexen und Schattenflächen, mit dem Quellen und Schwinden von Fasern und Fugen gezielt umzugehen. Dieses Verständnis kann nicht abstrakt gelernt oder beschrieben werden; es ist verkörpert und wird nur durch den Körper wahrgenommen. Die Physik einer solchen Architektur kann auch nur physisch – also über den Körper – erfahren und verstanden werden. Und so wird sie auch gelernt: durch das Mitmachen, das Handanlegen, das Selberbauen.

Das natürliche Wissen um das Material, seine Bearbeitung und Konstruktion ist „Erbgut“, tradierte Kultur. Es lässt sich historisch weit zurückverfolgen und kann als Konstante in der japanischen Baukultur verstanden werden. In ihm sind die Erfahrungen aus Jahrhunderten konzentrierter Arbeit versammelt. Bereits im Schrein von Izumo, dessen Ursprünge sich in archaischer Vorzeit verlieren, spürt man deutlich die Aufmerksamkeit und das Interesse der Baumeister für das Stoffliche und Körperliche. Der Schrein ist ein lebendiger Körper.
Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit
Die sinnliche, materialhafte Körperlichkeit der japanischen Architektur wurde selten übertroffen – doch sie ist kein Alleinstellungsmerkmal. Was japanische Architektur von ähnlich „begabten“ Baukulturen unterscheidet, ihr einen unverwechselbaren, nicht imitierbaren Charakter verleiht, ist eine andere Qualität. Die zweite Natur der japanischen Architektur ist ihre Mehrdeutigkeit und ihr Bedeutungsreichtum. Sie ist in besonderer Weise unscharf und vielschichtig. Damit entsteht das paradoxe Erlebnis einer zwar äußerst konkreten und fassbaren, gleichzeitig jedoch auch vagen Architektur. Vereinfacht gesprochen: während etwa die Schweizer Architektur eindeutig ist (Schiefer ist Schiefer, Holz ist Holz, ein Kubus ein Kubus), besitzt die erlebnisintensive japanische Architektur ein reiches Spektrum zusätzlicher Bedeutungsebenen. Sie entfaltet semantische Tiefe.

Roland Barthes hat diese Bedeutungshaltigkeit der japanischen Umwelt im „Reich der Zeichen“ (1970) beschrieben: Personen und Gesellschaft, Verhalten und Gegenstände, Räume und Materialien – alle sind mehrfach codiert. Im japanischen Teehaus etwa sind die Bewegungen und Gesten der Personen im Raum genau choreografiert – und ebenso besitzen die scheinbar willkürlich angeordneten Wandöffnungen, Fenster und Nischen vielfach definierte Bedeutungen und Aufgaben. Der Sinn für diese Vieldeutigkeit ist ebenso wie das besondere Interesse am Stofflichen und Materiellen eine kulturelle Prägung. Er ist über die Jahrhunderte gewachsen, in der Geistesgeschichte verankert – und damit kaum kopier- oder übersetzbar. Er funktioniert wohl nur im japanischen Kontext; nur hier ist er sinnvoll.
Im unmittelbaren architektonischen Erlebnis führt das zu einer besonderen Situation. Zwar sind die gestalteten Dinge vor uns deutlich und sinnlich konkret – sie sind aber nicht einfach lesbar bzw. erlebbar. Vielmehr sind sie von Grund auf vieldeutig: sie wurden so konzipiert und werden auch so wahrgenommen. Die japanische Kultur hat einen ausgeprägten Sinn dafür, Bedeutung in der Schwebe zu halten, in dem verschiedene Lesarten und Interpretationen übereinander gelegt werden. Der sorgsam platzierte Kiesel auf der Treppenstufe ist ein schöner Schmuck, ein Stück Gestaltung – gleichzeitig aber signalisiert er auch ein Zutrittsverbot.

Eindeutig Japanisch: Vieldeutig konkret
Jun’ichiro Tanizaki („Lob des Schattens“) und Kisho Kurokawa („Rikyu Grau“) haben die Kunst der Ambivalenz als Grundprinzip einer japanischen Ästhetik beschrieben. Aber auch diese Vagheit und Vielschichtigkeit sind sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal japanischer Architektur. Die westliche Kultur hatte diese Qualität schon mehrfach entdeckt. Vom Barock bis hin zu den opulenten postmodernen Zeichenarchitekturen der 1970er und 80er Jahre (die – nebenbei – in Japan eine besondere Blüte erreichten), verlangte das Gestaltungsempfinden auch im Westen immer wieder Symbole und Bedeutungen, semantische und emotionale Vielschichtigkeit.
Robert Venturis „Komplexität und Widerspruch in der Architektur“ (1966) war ein Abgesang auf die sterilen Glashallen der modernen Architektur, auf die weißen Kuben des Bauhauses. Was die postmoderne Architektur jedoch nicht leisten konnte, war die Verbindung einer solchen Bedeutungsvielfalt mit dem konkreten, körperlichen Erlebnis. Ihre Vielschichtigkeit war nicht materiell erlebbar oder greifbar. Meist war sie billig, appliziert, vormontiert. Sie war zwar im Kopf erlebbar, aber nicht im Körper.
Vor diesem Hintergrund versteht man die besondere Gestaltungskraft und Qualität japanischer Architektur. Sie ist zum einen vieldeutig und bedeutungsvoll, reich an Inhalt und Verweisen. Gleichzeitig aber ist sie äußerst konkret und sinnlich. Wir müssen in ihr „zwischen den Zeilen“ lesen, können sie aber auch körperlich erleben. In handwerklicher Perfektion ausgeführt ist diese Verbindung einzigartig. Sie kann weder kopiert noch imitiert werden.
ZU DEN AUTOREN: Jörg Rainer NOENNIG ist Juniorprofessor für Wissensarchitektur an der TU Dresden. Er hat u.a. an der Waseda Universität Tokyo studiert und war mehrere Jahre in Japan als Publizist und Architekt tätig, u.a. im Büro Arata Isozaki & Associates.
Benjamin HERRNSDORF ist Student der Architektur an der TU Dresden. Er hat u.a. am Lixil-Wettbewerb für das experimentelle Bauprojekt Taiki-cho in Hokkaido teilgenommen.
Der Artikel erschien im Japan Digest 2014. Für die Online-Ausgabe nachbearbeitet wurde er von Hannah Janz.
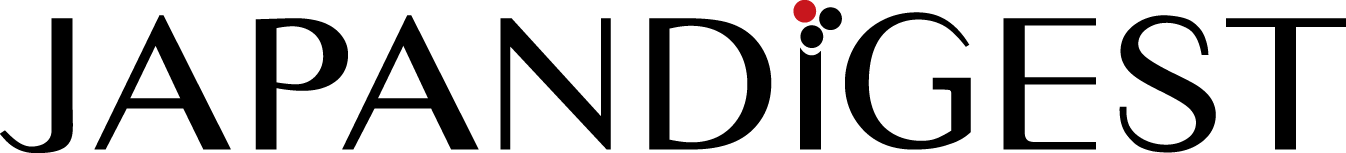




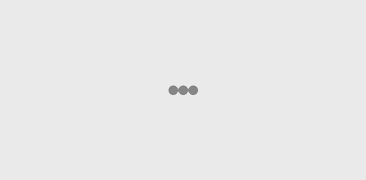




Kommentare