Die erste Begegnung zwischen dem Christentum und der japanischen Kultur begann Mitte des 16. Jahrhunderts, als im Jahr 1549 portugiesische Jesuitenmissionare unter der Führung von Francisco Xavier auf das japanischen Archipel kamen, um das einheimische Volk zu christianisieren. Die Japanerinnen und Japaner schienen eine gewisse Offenheit gegenüber der neuen Religion empfunden zu haben, denn ab 1580 strebten die Missionare die portugiesische und spanische Kolonialexpansion nach Asien an. Trotz einiger Fehlschläge konnten sie japanische Konvertiten dazu verleiten ihren Glauben weiterzuverbreiten, sodass damals das Verhältnis von Christen zu Nichtchristen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher war als heute.
Die Jesuiten haben nicht nur das Christentum verbreitet, sondern auch westliche Technologien wie Schusswaffen eingeführt. Die Feudalherren (daimyō) erhofften sich durch den Handel mit ihnen – in einer Zeit, in der Japan geprägt von Kämpfen um die Vorherrschaft war – einen wirtschaftlichen und politischen Vorteil, weshalb nicht wenige von ihnen zum christlichen Glauben konvertierten.
Verfolgung von Christen
Das Christentum wurde jedoch nicht von allen willkommen geheißen. Insbesondere das regierende Shogunat unter der Führung des Kriegsherren Tokugawa Ieyasu, welcher durch seinen Sieg in der Schlacht von Sekigahara 1600 die kriegerischen Auseinandersetzungen endgültig beendete und Japan als Nation einte, betrachtete es als eine Religion ausländischer Invasoren mit eigennützigen Absichten und somit als ernsthafte Bedrohung für die innere Stabilität und nationale Sicherheit. Durch Regierungserlasse ließ er 1614 das Christentum verbieten und europäische Missionare ausweisen. Japanische Konvertiten wurden systematisch verfolgt und einige öffentlich hingerichtet. Viele sahen sich im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte gezwungen, ihren Glauben als „versteckte Christen“ (kakure kirishitan) im Geheimen zu praktizieren und weiterzugeben.
Der Höhepunkt des Konflikts zwischen japanischen Christen und dem Shogunat war der sogenannte Shimabara-Aufstand, welcher von 1637-1638 auf der Shimabara-Halbinsel auf Kyūshū stattfand. Anfangs versammelten sich Bauern, viele von ihnen getauft, um gegen die wirtschaftliche Ausbeutung ihres Feudalherren zu demonstrieren. Jedoch richtete sich der Protest im Laufe des Kampfes immer mehr gegen die drastische Umsetzung des Christenverbots. Angeführt vom jungen konvertierten Bauern Amakusa Shirō, wandelte sich dieser schnell zur Symbolfigur des Widerstands. Die Eroberung und anschließende Belagerung der Burg Hara hielt jedoch nur ein paar Monate an. Amakusa und seine Kameraden wurden hingerichtet und ihre enthaupteten Köpfe zur Abschreckung potenzieller Rebellen in Nagasaki öffentlich aufgestellt.

Der Aufstand bedeutete einen Wendepunkt des Christentums in Japan und leitete weiterhin die rigorose Abschottungspolitik (sakoku) Japans gegenüber ausländischen Einflüssen ein, welche bis Mitte 19. Jahrhunderts andauern würde.
Um Christen ausfindig zu machen, mussten Japaner:innen einmal im Jahr auf den Ikonen von Jesus und der Jungfrau Maria in Form von „Tret-Bildern“, fumie oder efumi genannt, herumtrampeln. Ebenso waren sie gezwungen, den Buddhismus als Religion zu akzeptieren, indem sie sich bei ihrem örtlichen Tempel registrierten und eine Mitgliedskarte erhielten. Dieses sogenannte „Danka-System“ sollte die Bevölkerung kontrollieren und die Ausbreitung des Christentums verhindern. Identifizierte Christen wurden gekreuzigt, in heiße Quellen geworfen oder verbannt.
Maria-Kannon
Um ihren Glauben im Geheimen praktizieren zu können, mussten sich konvertierte Japanerinnen und Japaner kreative Methoden einfallen lassen, um nicht entdeckt zu werden. Das berühmteste Beispiel ist die sogenannte Maria-Kannon. Diese im 17. Jahrhundert aufgekommenen Statuen sind eine Synthese zweier bedeutender religiöser Figuren, der Jungfrau Maria der buddhistischen Gottheit Kannon.
Die Maria-Kannon wurde gewöhnlich für die stille Verehrung der Gottesmutter Maria verwendet indem man ihr das Aussehen der Kannon verlieh. Beide stehen für Mitgefühl, Gnade und Barmherzigkeit. Diese Ähnlichkeit führte zu einer Art Verschmelzung buddhistischer und christlicher Vorstellungen und machte Maria-Kannon zu einer Symbolfigur dieses Synkretismus.
Neben der Maria-Kannon versteckten die kakure kirishitan auch Kreuze in buddhistischen Statuen, die bei Beerdigungen von Familienangehörigen aufgestellt wurden. Ebenso drehte man Teeschalen bei der japanischen Teezeremonie vor dem Trinken dreimal um, was die Heilige Dreifaltigkeit symbolisierte. Speziell gefaltete Servietten sollten Eingeweihte darauf hinweisen, wann ein christliches Gebet leise aufzusagen war.

Gnadenbilder und okake-e
Mit der Einführung des Christentums fand auch ein intensiver kultureller Austausch mit westlicher Kunst statt. Insbesondere das Gnadenbild Salus Populi Romani aus der Capella Paolina der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom hinterließ große Spuren in der Gesellschaft. Eine Kopie dieses Lukasbildes der Jungfrau Maria mit dem Christuskind kam mit den Jesuiten als neues Missionarsmedium auf das japanische Archipel. In der Malerschule „Seminario dei Pittori“ des italienischen Jesuitenmalers Giovanni Niccolò reproduzierten japanische Schüler:innen mehrere Kopien des Bildes und entwickelten dabei neue Maltechniken.
Mit der Meiji-Restauration ab 1868 und der damit verbunden Öffnung Japans gegenüber dem Ausland sowie der Aufhebung des Verbots des Christentums, kehrten Missionare nach Japan zurück. Viele kakure kirishitan traten der katholischen Kirche bei, doch einige weigerten sich und hielten weiterhin an den Praktiken ihrer Familie fest. Diese variierten unter den einzelnen Gemeinden und Regionen stark.
Eine dieser Praktiken war das okake-e, auf Schriftrollen gemalte und aufgehängte christliche Darstellungen der Jungfrau Maria, Jesus Christus oder anderen Heiligen. Sie dienten als Gegenstand der Anbetung sowie als Identität der kakure kirishitan-Gemeinden und wurden deshalb nur in privaten Haushalten aufbewahrt.

Die Anhänger reproduzierten christliche heilige Bilder, wenn die vorherigen beschädigt wurden. Interessanterweise wird der Akt der Reproduktion osentaku genannt, was „Wäsche“ bedeutet, und beschädigte und nicht mehr verwendete okake-e werden als inkyo bezeichnet, was man als „Rückzug“ oder „Rücktritt“ übersetzen kann. Obwohl kaum etwas über ihr Datum oder ihre Zuordnung bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass zuerst Werke im Seminar von Giovanni Niccolò entstanden sind und die Bilder im osentaku-Prozess nach und nach japanische Merkmale wie Kimono und traditionelle Frisuren annahmen.
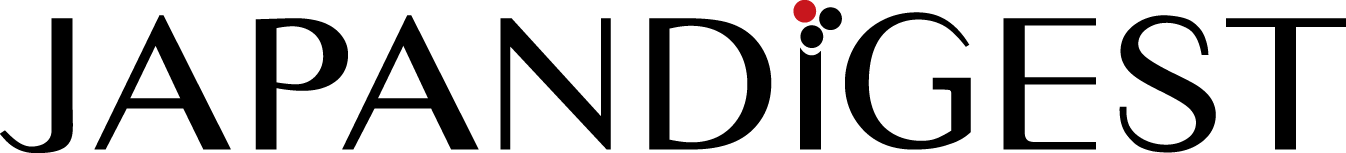




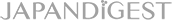



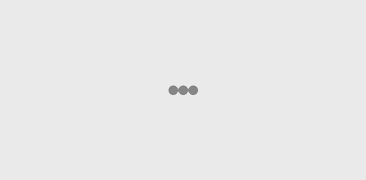




Kommentare