Während der Meiji-Zeit (1868–1912) durchlief Japan tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. In dem Bestreben, mit den westlichen Nationen gleichzuziehen, wurde Bildung eine der zentralen Säule des neuen Nationalstaats. Auch Mädchen und Frauen wurden zunehmend in das Bildungssystem eingebunden – eine radikale Veränderung der stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft.
Doch mit der Öffnung der Bildungseinrichtungen für Frauen stellte sich eine sehr praktische Frage: Was sollten die Schülerinnen tragen? Die traditionellen Kimonos mit engen Ärmeln und langem Saum galten als ungeeignet für den Schulalltag; vor allem, da auch Sport und Bewegung Teil des Lehrplans sein sollten.
Vom Männergewand zur Tracht der Schülerinnen
Die Lösung kam in Form eines Kleidungsstücks, das bis dahin ausschließlich Männern vorbehalten war: der hakama. Ursprünglich ein Hosenrock, der hauptsächlich von Samurai getragen wurde, wurde der hakama speziell für Schülerinnen neu interpretiert. Statt der typischen Männerform mit zwei Beinöffnungen (umanori hakama) wurde ein weiter, rockähnlicher hakama eingeführt, der mehr Bewegungsfreiheit ermöglichte und gleichzeitig, so die Argumentation, dem sittlichen Ideal weiblicher Zurückhaltung entsprach.
Diese modifizierte Form wurde im Jahre 1898 zum Standard an vielen Mädchenschulen, insbesondere in Kombination mit einer weißen Bluse und einem gemusterten langärmligen furisode-Kimono. Die neue Uniform sollte Fortschritt, Disziplin und Modernität signalisieren; alles Werte, die dem aufstrebenden Nationalstaat am Herzen lagen.

Bewegung, Fortschritt und das Fahrrad
Die Wahl des hakama war nicht nur eine pragmatische Entscheidung. Sie spiegelte auch ein neues Körperbewusstsein wider. Körperliche Ertüchtigung und sportliche Aktivitäten wurden im Schulcurriculum fest verankert. Damit wuchs auch die Notwendigkeit nach Kleidung, die Bewegungsfreiheit zuließ.
Zeitgleich setzte sich das Fahrrad unter jungen Männern sowie Frauen als neues Fortbewegungsmittel durch. Um damit sicher und bequem fahren zu können, erwies sich der hakama als ideal. Der Wechsel von traditionellen Holzsandalen (geta) zu modernen Schnürschuhen oder Stiefeln unterstrich zusätzlich den Wandel im Alltagsleben junger Frauen. So wurde der hakama zunehmend zum Sinnbild der sogenannten haikara (ハイカラ; von dem Englischen high collar): junge, moderne Frauen mit westlich inspiriertem Lebensstil und Bildungsanspruch. Diese neuen Frauenbilder fanden nicht nur in der Realität, sondern auch in der Popkultur Ausdruck.
Haikara und der popkulturelle Nachhall
Ein bekanntes Beispiel für die kulturelle Verankerung des hakama-Looks ist der Shōjo-Manga Mademoiselle Hanamura von Yamato Waki, der zwischen 1975 und 1977 erschien. Die Geschichte spielt im frühen 20. Jahrhundert, zur Zeit der Taishō-Ära (1912-1926), und erzählt vom Leben der jungen Hanamura Benio. Die Protagonistin ist eine aufgeweckte, eigensinnige Schülerin in Tōkyō, die sich nicht mit den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit abfinden will.
Benio liebt westliche Mode, liest Romane, reitet, fechtet, fährt Fahrrad und träumt davon, Journalistin zu werden, statt früh zu heiraten, wie es von ihr erwartet wird. Ihr markantes Outfit, ein langärmeliger furisode-Kimono mit auffälligem yabane-Muster (ein geometrisches Pfeilfedermuster, das für Zielstrebigkeit steht), kombiniert mit einem weit geschnittenen hakama und Schnürstiefeln, sowie langem, fliegenden Haar mit großer Schleife, visualisiert wie keine anderes die haikara-Bewegung. Die Figur der Hanamura Benio spiegelte daher nicht nur historische Realitäten wider, sondern wurde für viele Leserinnen selbst zur Projektionsfläche eines modernen, selbst bestimmten Frauenbilds.
Der Hakama als Symbol der Emanzipation heute
Bis heute hat sich diese Symbolik des hakama erhalten, besonders bei feierlichen Anlässen wie der sotsugyō-shiki, der Universitätsabschlussfeier. Viele junge Frauen wählen bewusst die Kombination aus Kimono und hakama, um damit nicht nur ihre persönliche Reife, sondern auch ihre Bildung und Selbstständigkeit zu unterstreichen. Der Look steht für einen Neubeginn; ähnlich wie es einst für die Schülerinnen der Meiji- und Taishō-Zeit galt, die mit dem Tragen des hakama ihre aktive Rolle in einer sich wandelnden Gesellschaft sichtbar machten.

Der hakama steht heute nicht nur für Tradition, sondern auch für Wandel. Er erzählt die Geschichte einer Gesellschaft im Aufbruch und von Frauen, die sich ihren Platz in Bildung, Beruf und Gesellschaft erkämpft haben. Wer also bei einer Abschlussfeier in Japan eine junge Frau im hakama sieht, sieht weit mehr als nur ein schönes Outfit; man sieht ein Stück lebendige Geschichte.
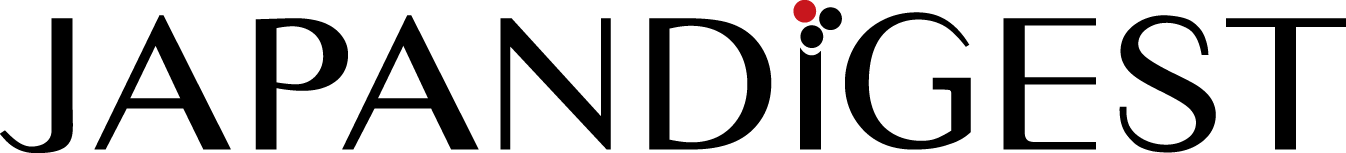



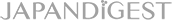


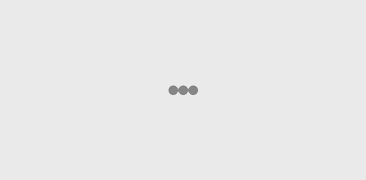




Kommentare