Each part of the world recapitulates, shares in and experiences the history of the world as a whole.
Fernand Braudel
In Kyōto findet 2019 der nächste Weltkongress des ICOM (International Council of Museums) statt, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tōkyō. Dies ist ein guter Anlass, sich mit der Bedeutung der Museen für unsere Gesellschaften und den interkulturellen Dialog zu befassen.
Unter dem Motto „Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition“ werden sich mehr als 4.000 Teilnehmer aus 130 Ländern in der alten Kaiserstadt Kyōto versammeln. Das letzte ICOM-Welttreffen – alle drei Jahre findet es statt – in Mailand stand unter dem Motto „Museums and Cultural Landscapes“.
ICOM ist eine Organisation der UNESCO. 1945 wurde die UNESCO gegründet in der Absicht, den erreichten Frieden zu fördern und zu bewahren. Erziehung, Kultur und Wissenschaft sollten dazu beitragen, das Motto der UNESCO, wie man es heute auf der Homepage findet: „Building peace in the minds of men and women“ mit Leben zu erfüllen. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, ist den Museen eine sehr wichtige Aufgabe zugedacht. Zuletzt 2015 hat die UNESCO auf ihrer 38. Generalkonferenz die „Recommendation on the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society“ angenommen. Auch das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, dass die teilnehmenden Nationen 1972 auf der 17. Generalkonferenz beschlossen, gehört zu jenen Bestrebungen. 1978 wurden die ersten Orte des Weltkulturerbes benannt, in Japan sind es heute 53, in Deutschland 86.
Museen sind soziales Kapital und immer auch Teil einer Cultural Diplomacy. Zwar weiß ICOM nach eigenen Angaben nicht genau, wieviele Museen es heute auf der Welt gibt, doch man schätzt, dass es 1975 mehr als 22.000 und 2014 mehr als 55.000 waren. In Deutschland und Japan gibt es aktuell etwa je 6.000, in den USA 35.000 Museen. 20.000 Museen sind im ICOM vertreten, 35.000 Mitglieder zählt die Organisation heute. ICOM ist die größte global agierende Museumsinstitution.
2019 also werden die Museumsfachleute in Kyōto, in einer der schönsten Städte der Welt, tagen. Der historische Teil der Stadt ist seit 1994 Weltkulturerbe der Menschheit. In einem hoffentlich nicht nur imaginären Besuchsprogramm könnten die Gäste auch die nahe gelegene historische Stadt Nara erkunden, Weltkulturerbe seit 1998. Und vielleicht findet in einem der Museen in Nara dann eine Ausstellung statt, die dem ältesten Museum der Welt gewidmet ist, der kaiserlichen Sammlung Shōsō-in, deren Geschichte bereits im 8. Jahrhundert beginnt. Und nur eine kurze Zugfahrt entfernt befindet sich eines der ältesten buddhistischen Heiligtümer Japans, der Hōryu-Tempel, dessen Geschichte im 7. Jahrhundert beginnt und der ebenfalls seit 1998 Weltkulturerbe ist. Nach der Tagung, vor dem Abflug in Tōkyō, ließe sich auch der Besuch der Nationalmuseen im Ueno-Park empfehlen – und dort insbesondere der grandiose Museumsbau von Taniguchi Yoshio aus dem Jahre 1999, der den Schätzen eben dieses Hōryu-Tempels gewidmet ist.
Taniguchi – wir bleiben in der Museumswelt – erhielt in der Folge um 2000 den Auftrag, einen Erweiterungsbau im Garten des Museum of Modern Art (moMA) in New York zu errichten, der dann aus Anlass des 75. Geburtstages des MoMA im Jahre 2004 eröffnet werden konnte und den man als genial bezeichnen muss. Das Credo des Architekten: „Kunst, Architektur und Menschen tragen zur Museumsatmosphäre bei – wie bei der japanischen Teezeremonie, wo die Teetasse von sehr einfacher Form und Farbe ist. Einmal mit Tee gefüllt, verwandelt sie sich aber in ein neues Objekt“.
Doch welche Zukunft hat das Museum in einer Welt, in der zunehmend digitalisierte Inhalte dominieren? Wird das Original im Museum, wird das Museum selbst im Wettstreit mit Internet und Smartphone bestehen können? Es gibt gute Gründe Letzteres anzunehmen.
Das Wort Museum leitet sich vom griechischen „Musaion“ ab. Es war der Ort an dem man – Hesiod folgend – in der Antike die neun Musen, Töchter der Mnemosyne, verehrte. Mneme bedeute soviel wie Gedächtnis. Museen, in Europa eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, kann man als jene Orte betrachten, in denen Erinnerungen bewahrt und erklärt werden. Im Museum spiegeln sich die Identitäten der umgebenden Kultur. Museen sind unser Gedächtnis.
1994 erfunden ist das Smartphone heute ubiquitär. Es ist zugleich: Film- und Videokamera, Fotoapparat, Fernseher, Telefon, Fax, Kalender, Schreibmaschine, Rechner – um mittlerweile altertümliche Worte zu nutzen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat ein Gerät so viele Zwecke vereint, auf weniger als Handtellergröße. Doch die Museen müssen sich der Herausforderung des Internets und des Smartphones stellen, das „Gerät“ als Chance begreifen.
Jugendliche in Deutschland im Alter zwischen 12 und 19 Jahren nutzen das Smartphone 179 Minuten, davon 100 Minuten für Spiele. 94% der 6- bis 18jährigen nutzen das „Gerät“, das unsere Kommunikationswege revolutioniert. Gegen diesen „use of time“ müssen die Museen arbeiten. Oder sollte man besser sagen, sie werden ihn nutzen müssen für ihre Zwecke. 2,3 Milliarden Menschen nutzen das „Gerät“ weltweit. Das bietet große Möglichkeiten für jenen Teil der Industrie, den man Creative Industries nennt.
Auch die Ökonomen interessieren sich für die Museen: Die 35.000 Museen der USA setzen 24 Milliarden Dollar im Jahr um und haben 850 Millionen Besucher. The Economist widmete 2013 dem Thema eine große Geschichte und berichtete folgende jährliche Besucherzahlen: China 500 Millionen, Japan 161 Millionen, Deutschland 109 Millionen. Und Themed Entertainment Association(TEA) vergleicht die großen Museen der Welt im Jahre 2015 mit Themenparks. Die Museen kommen immerhin auf stattliche Zahlen: der Louvre auf 8,7, das Nationalmuseum Peking auf 7,3, das British Museum auf 6,8. Das Metropolitan Museum New York auf 6,3 Millionen Besucher jährlich. Disneyland Florida kommt auf 20 Millionen. Es gibt also viel zu tun für die Museumsexperten.

Prof. Gereon Sievernich ist Direktor des Martin-Gropius-Baus der Berliner Festspiele in der KBB GmbH und Mitglied des JDZB-Stiftungsrats. Dieser Artikel ist ein Gastbeitrag des vierteljährlichen Newsletters “jdzb echo”, der vom Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin publiziert wird. Der Beitrag wurde von Prof. Gereon Sievernich für die Juni 2017-Ausgabe verfasst.
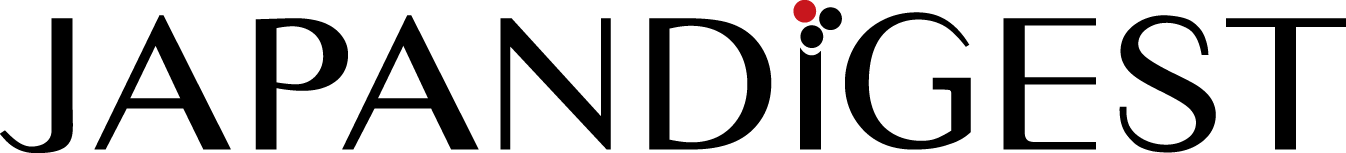




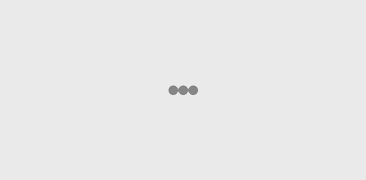




Kommentare