Seit einigen Jahren steht fest: Tōkyō darf zum zweiten Mal in seiner wechselvollen Geschichte die olympischen Sommerspiele ausrichten – 56 Jahre nach dem ersten Mal.
Und was da nicht alles vor den ersten Olympischen Sommerspielen 1964 geschah: Tōkyō war dabei, die Nachkriegszeit endgültig hinter sich zu lassen. Fast die Hälfte der auch heute noch wichtigsten Infrastrukturprojekte in Tōkyō wurden damals in schwindelerregender Geschwindigkeit durchgezogen. Man wollte sich schließlich als moderne, weltoffene und boomende Metropole präsentieren.
Die Ziele haben sich nicht geändert. Dieses Mal warb man vor allem mit der vielgerühmten Omotenashi おもてなし – der japanischen Gastfreundlichkeit. Aber halt, gibt es die nicht auch anderswo, nicht selten sogar extremer? Nicht ganz. Ein essentieller Teil von Omotenashi ist, dass man Gästen Wünsche erfüllt, die die Gäste noch nicht einmal geahnt, geschweige denn geäußert hätten. Das schlägt sich vor allem in der Freundlichkeit und dem hohen Maß an Service nieder.
Doch die Planung der Spiele verlief und verläuft dieses Mal erstaunlich unharmonisch. So einigte man sich zum Beispiel auf ein Logo der Spiele, nur um danach festzustellen, dass jenes eindeutig ein Plagiat war. Schlimmer noch: Der Designer behauptete stur, das Original nicht zu kennen, obwohl die Ähnlichkeit wirklich eindeutig den Zufallsbereich verlassen hat. Das Abkupfern trifft dabei einen empfindlichen Nerv, denn dies ist genau das, was man hierzulande den Chinesen (in nicht wenigen Fällen zurecht, wohlgemerkt) vorwirft.
Auch bei den Wettkampfstätten gibt es ordentlich Zoff: Zum einen um exorbitante Kosten für das zentrale Stadion in Yoyogi, aber auch um die Ortslage selbst: Andere Präfekturen sollen oder wollen auch Wettkämpfe austragen, zum Beispiel Miyagi hoch im Norden der Insel, aber wenn es um die Kostenfrage geht, sind die Fronten verhärtet.
Spannend ist auch die Frage danach, wie man mit den zu erwartenden Sportlern und Besuchern kommunizieren möchte. Das Bildungsministerium hat das Problem erkannt und beschlossen, dass erstmal auch Fünft- und Sechstklässler an der Schule Englisch lernen müssen – und bald auch Dritt- und Viertklässler. Leider hat man versäumt, dies auch in der Lehrerschaft vorzubereiten oder zumindest die Stundenpläne der Mittel- und Oberstufen anzupassen, so dass dieser Maßnahme wohl nur ein geringer Erfolg zuteil werden wird.
Es gibt allerdings auch interessante Pilotprojekte: In Okayama zum Beispiel, zwar weit weg von Tōkyō aber dennoch als Vorbild relevant, schickt man Grundschüler mit sehr guten Englischkenntnissen in den bekannten Garten der Stadt, um dort den ausländischen Besuchern etwas von der Geschichte zu vermitteln. Die Besucher kommen in den Genuss einer (kostenlosen) Führung und die Kinder hingegen können ihre Englischkenntnisse polieren und Kontakte knüpfen.
Auch die Industrie stellt sich immer mehr auf die Spiele ein. So bietet Panasonic ein Megafon an, dass das auf Japanisch Durchgesagte umgehend in diverse Sprachen übersetzt. Schöner wäre es natürlich, wenn man nicht allzu oft auf das Megafon zurückgreifen müsste.
Just keimte jedoch noch eine weitere Diskussion auf, und hier darf man gespannt sein, welche Lösung man sich einfallen lassen wird. Es mehren sich besorgte Stimmen, dass die enorme Hitze und Luftfeuchtigkeit den Sportlern und Besuchern zu viel zumuten könnte. Sicher, 1964 war das auch kein Problem. Und da gab es kaum Klimaanlagen. Doch die sind heutzutage gleichzeitig das Problem, da sie maßgeblich zum sogenannten Hitzeinselphänomen beitragen. Die Temperaturen im unmittelbaren Stadtzentrum sind deshalb heute stellenweise bis zu 10 Grad höher als noch vor 50 Jahren. Zwar gab es zum Beispiel Pläne, quasi alle Stadtautobahnen komplett unter die Erde zu verlegen und die freiwerdenden Flächen möglicherweise zu entsiegeln, doch dafür reichen weder Zeit noch Geld.
Fazit: Es sind noch drei Jahre Zeit bis zu den Olympischen Spielen, und Japan freut sich auf das Großereignis. Bis dahin gibt es allerdings noch sehr viel zu tun.
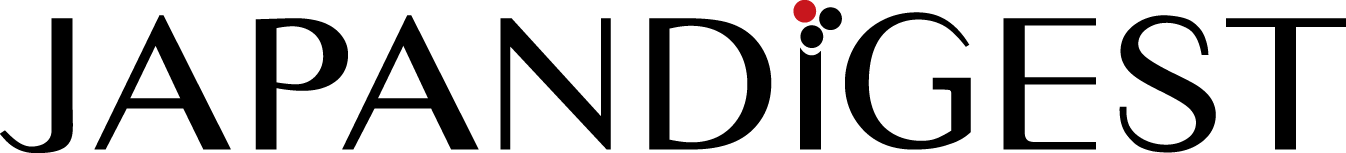




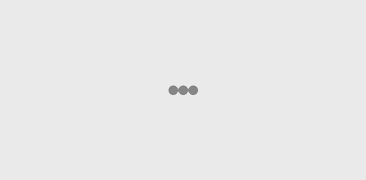




Kommentare